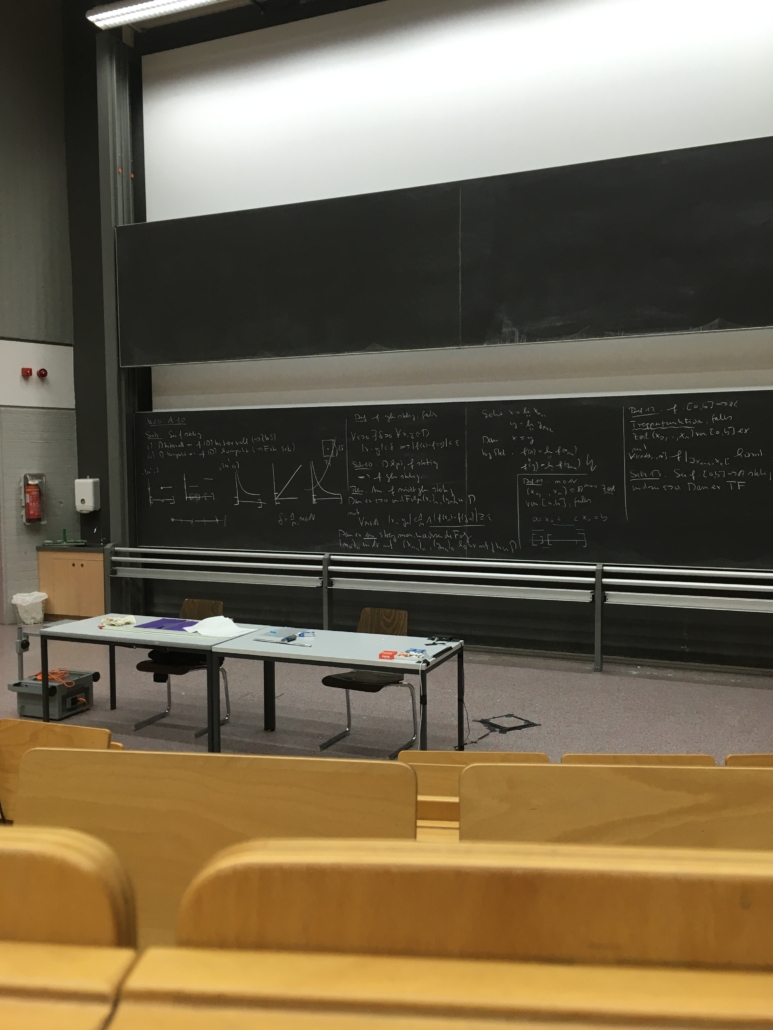Plenarsitzung im Landtag
Am Ende meines Praktikums in der CDU-Fraktion hatte ich das Glück, an einer Plenarsitzung vom Niedersächsischen Landtag teilnehmen zu dürfen. Hier sitzen alle Abgeordneten des Landtags zusammen im großen Plenarsaal und beraten über verschiedene Gesetzesentwürfe und stimmen über diese ab. Plenarsitzungen wie diese finden jeden Monat über einen Zeitraum von drei Tagen statt und werden meist von vielen Zuschauern besucht.

Dies konnte ich schon beobachten, als ich am Morgen der Plenarsitzung mit dem Fahrrad an mehreren Schülergruppen vorbei gefahren bin, die bereits vor dem Eingang des Parlaments gewartet haben. Ich habe von meinem Ansprechpartner eine Logenkarte bekommen und durfte mit anderen Praktikanten und Beratern in der Loge der CDU Platz nehmen, die sich auf einer Höhe mit den Abgeordneten befindet. Die anderen Zuschauerränge sind wie Tribünen aufgebaut, die etwas erhöht und somit von den Abgeordneten distanziert sind.
Im Niedersächsischen Landtag sitzen 137 Abgeordnete, davon gehören 50 zur CDU-Fraktion und 54 zur SPD-Fraktion. Diese beiden Fraktionen haben sich zu einer großen Koalition zusammengeschlossen und bilden so auch die Regierung. Diese Regierung um Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sitzt ebenfalls im Plenarsaal auf den Regierungsbänken. Im Mittelpunkt vom Plenarsaal ist der Sitz der Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD), die auch die Plenarsitzung eröffnet und schließt.
Rede zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz
Zu Beginn des ersten Tags der Plenarwoche hielt der Professor Shaul Ladany, ein Überlebender des Holocaust, eine sehr bewegende Rede anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, die vom gesamten Parlament viel Applaus erhielt. Danach folgten die ersten sogenannten „Aktuellen Stunden“, die von jeder der fünf Fraktionen im Landtag im Voraus eingereicht wurden. In diesem Tagesordnungspunkt berät das Parlament über ein aktuelles Thema, wie beispielsweise der „Schutz vom Ehrenamt und der Demokratie“.
 Darüber hinaus debattiert der Landtag über neue Gesetzesentwürfe, die von den Fraktionen vorher in den zuständigen Ausschüssen eingebracht worden sind. In den abschließenden Beratungen stimmen die Abgeordneten dann über diese Gesetzesentwürfe ab. Für diese Abstimmungen liegen den Abgeordneten Ausschussempfehlungen vor, da über die Anträge bereits vorher von einem kleinen Teil der Abgeordneten in den dazugehörigen Ausschüssen abgestimmt wurde.
Darüber hinaus debattiert der Landtag über neue Gesetzesentwürfe, die von den Fraktionen vorher in den zuständigen Ausschüssen eingebracht worden sind. In den abschließenden Beratungen stimmen die Abgeordneten dann über diese Gesetzesentwürfe ab. Für diese Abstimmungen liegen den Abgeordneten Ausschussempfehlungen vor, da über die Anträge bereits vorher von einem kleinen Teil der Abgeordneten in den dazugehörigen Ausschüssen abgestimmt wurde.
Fazit der Plenarwoche
Insgesamt war es sehr interessant bei so einer Plenarwoche dabei zu sein, weil in diesen Sitzungen alle Anträge und Entwürfe der letzten Wochen zusammenkommen und hier abschließend abgestimmt werden. Einige Themen, über die vorher in Ausschusssitzungen, in denen ich ebenfalls war, beraten wurde, konnte ich in der Plenarsitzung wiederfinden. Für mich war dies also ein gutes Ende für meinee Zeit im Landtag.


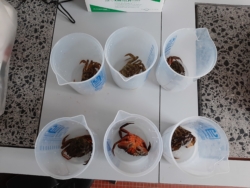


 irken wurden viereckige Steine in die Passage hineingelassen. An diesen Steinen verfangen sich jedoch Äste und sonstiger Unrat. Dies verhindert, dass das Wasser den, von den Architekten hervorgesehenen Strom folgt. Das Wasser fliesst an manchen Stellen somit zu schnell. Der Unterschied des Wasserstandes zwischen den Etappen weicht somit sehr stark voneinander ab, sodass die Fische keine Chance mehr haben diese Passage flussaufwärts zu durchqueren.
irken wurden viereckige Steine in die Passage hineingelassen. An diesen Steinen verfangen sich jedoch Äste und sonstiger Unrat. Dies verhindert, dass das Wasser den, von den Architekten hervorgesehenen Strom folgt. Das Wasser fliesst an manchen Stellen somit zu schnell. Der Unterschied des Wasserstandes zwischen den Etappen weicht somit sehr stark voneinander ab, sodass die Fische keine Chance mehr haben diese Passage flussaufwärts zu durchqueren.

 wirkt. Die Stromgeschwindigkeit darf durch diesen Eingriff nicht zu zu stark abnehmen. Dieser Aspekt ist Teil des Promotionsvorhaben von Herr Blotnicki.
wirkt. Die Stromgeschwindigkeit darf durch diesen Eingriff nicht zu zu stark abnehmen. Dieser Aspekt ist Teil des Promotionsvorhaben von Herr Blotnicki.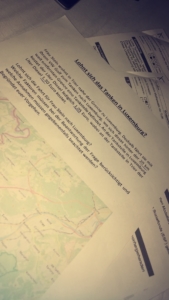 Heute erfüllten wir typische Praktikantenklischees. Wir halfen nämlich einer Doktorandin bei ihrer Doktorarbeit. Sie schreibt über die Gruppenprozesse beim mathematischen Modellieren, also wie sich eine Gruppe verhält, wenn sie ein mathematisches Problem gestellt bekommen, dass aus dem Alltag kommt.
Heute erfüllten wir typische Praktikantenklischees. Wir halfen nämlich einer Doktorandin bei ihrer Doktorarbeit. Sie schreibt über die Gruppenprozesse beim mathematischen Modellieren, also wie sich eine Gruppe verhält, wenn sie ein mathematisches Problem gestellt bekommen, dass aus dem Alltag kommt.